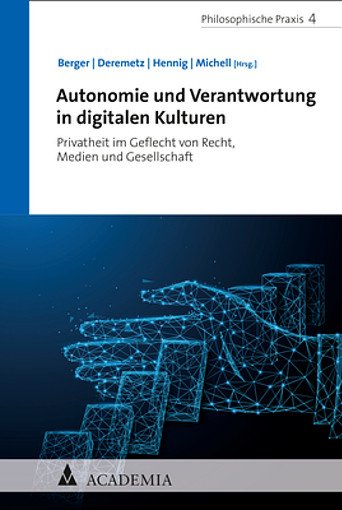
Berger, Franz X./Demeretz, Anne/Hennig, Martin/Michell, Alix (Hrsg.) (2021): Autonomie und Verantwortung in digitalen Kulturen. Privatheit im Geflecht von Recht, Medien und Gesellschaft. Baden-Baden: Academia Verlag.
Die zunehmende Komplexität vernetzter Systeme weckt grundsätzlich Zweifel an der Selbstbestimmtheit im Digitalen. Fremdbestimmende Algorithmen und Praktiken der Selbst- und Fremdverdatung werfen Fragen nach Schutz und Gefährdung von Autonomie und Meinungsfreiheit auf. Gleichwohl bleibt die rechtliche, politische, ethische, soziale und ökonomische Verantwortlichkeit für die Folgen digitaler Transformationsprozesse für Gesellschaften, Kollektive und Individuen noch ungeklärt.
In diesem Spannungsfeld möchte dieser interdisziplinäre Band eine Diskussion zu Verantwortungen und Folgenabschätzungen anregen. Es werden Problemlagen innerhalb digitaler Kulturen eruiert, mögliche Steuerungsmöglichkeiten besprochen und Konflikte von ökonomischen, politischen und sozialen Systemen diskutiert.
Hier finden Sie die Onlineversion.
Franz X. Berger, Anne Deremetz und Martin Hennig: Privatheit, Autonomie und Verantwortung in digitalen Kulturen: Einleitung
1. Autonomie und Verantwortbarkeit in digitalen Macht- und Herrschaftsmechanismen
Julia Valeska Schröder: Digitale Subjektivierungsmacht als Technologie des Selbst und Digitales Selbst. Eine zweifache machttheoretische Annährung an das Subjekt der Privatheit
Philipp Siedenburg und Tim Raupach: Big Data und die (Re-)Produktion gesellschaftlicher Ordnung. Zu den normativen Implikationen der Digitalisierung
Jens Crueger und Thomas Krämer-Badoni: Selbstlernende Programme als Verantwortungsdilemma
Stephan Dreyer und Amélie Heldt: Algorithmische Selektion und Privatheit. Aufmerksamkeitssteuerung durch Social Media-Plattformen als Autonomieeingriff?
2. Normenkonflikte und kollektive Dynamiken digitaler Gesellschaften
Wulf Loh: Informationelle Privatheit, Standardautorität und soziale Pathologien
Christian Thies: Digitale Erregungen. Das Ressentiment im Zeitalter des Internets
Anna K. Bernzen: Privatheit vs. Öffentlichkeit. Neue Regeln für Berichte aus dem Gerichtssaal
Christian Lenk: Das Recht auf Nichtwissen als Element von Privatheit in der modernen Medizin?
3. Anonymität und Transparenz, Autonomie und Verantwortung in digitalen Öffentlichkeiten
Lea Watzinger: Namenlos, durch das Netz. Anonymität und Transparenz in digitalen Kulturen
Hans-Christian Gräfe und Andrea Hamm: Anonymität im Internet. Interdisziplinäre Rückschlüsse auf Freiheit und Verantwortung bei der Ausgestaltung von Kommunikationsräumen
Carsten Ochs und Barbara Büttner: Profilierungsdynamik. Eine ethnographische Bestandsaufnahme der Konsequenzen datafizierter Moderne
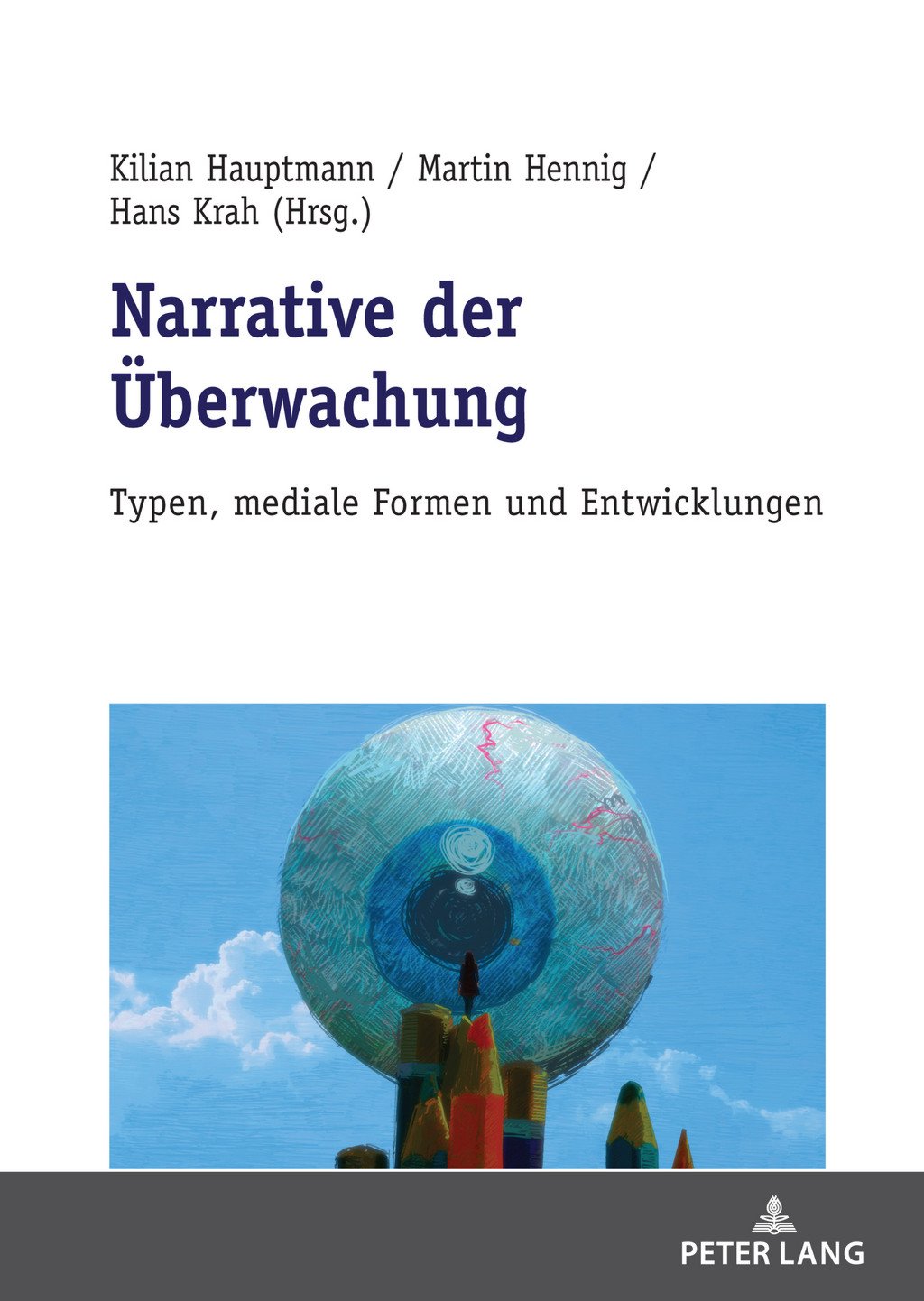
Hauptmann, Kilian/Hennig, Martin/Krah, Hans (Hrsg.) (2020): Narrative der Überwachung. Typen, mediale Formen und Entwicklungen. Berlin: Verlag Peter Lang.
In Film und Literatur gibt es durch kanonisierte Überwachungserzählungen eine Vielzahl von Narrativen der Überwachung, die in das Alltagswissen übergegangen sind und die kulturellen Verhandlungen und Vorstellungen von Privatheit und Autonomie prägen. Doch auch in einer Vielzahl von anderen Medien und Diskursen lassen sich Narrative der Überwachung finden, wie etwa im Computerspiel, in der Werbung, in Dokumentationen oder der Aktionskunst, und nicht zuletzt in der Wissenschaft selbst. Der Band widmet sich Modellierungen von Überwachung und geht Entwicklungen von Erzählungen und Diskursen anhand von verschiedenen Beispielen nach. Die interdisziplinären Perspektiven nehmen dabei auch das Verhältnis der Überwachungsnarrative zu Sicherheits-, Privatheits- und Digitalisierungsthemen in den Blick.
Hier finden Sie die Onlineversion. Der Band basiert auf der gleichnamigen Ringvorlesung.
Kilian Hauptmann/Martin Hennig/Hans Krah: Einleitung
Martin Hennig/Hans Krah: Typologie, Kategorien, Entwicklung von Überwachungsnarrativen: zur Einführung
Sabrina Huber: Literarische Narrative der Überwachung – Alte und neue Spielformen der dystopischen Warnung
Maren Conrad: The Quantified Child. Zur Darstellung von Adoleszenz unter den Bedingungen der Digitalisierung in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur
Dietmar Kammerer: Give them something to watch. Videoüberwachung als Motiv in Werbung
Marcel Schellong: The Gamer’s Panopticon – Überwachung und Kontrolle als Motiv und Prinzip des Computerspiels
Miriam Frank: Überwachungsnarrative im Dokumentarischen. Konstruierte Untergangsstimmung im deutschsprachigen Fernsehen
Alix Michell: Überwachung ist Macht. Zur Mythifizierung von Überwachung in der Gegenwartskunst
Thomas Christian Bächle: Narrative der digitalen Überwachung
Lukas Raabe: „Arbeite mit, plane mit, regiere mit!“ – Doch bis wohin? Reflexionen zur Produktion deutscher Zeitgeschichte(n) und zum Quellenwert archivierter Überwachungsdokumente der DDR-Diktatur
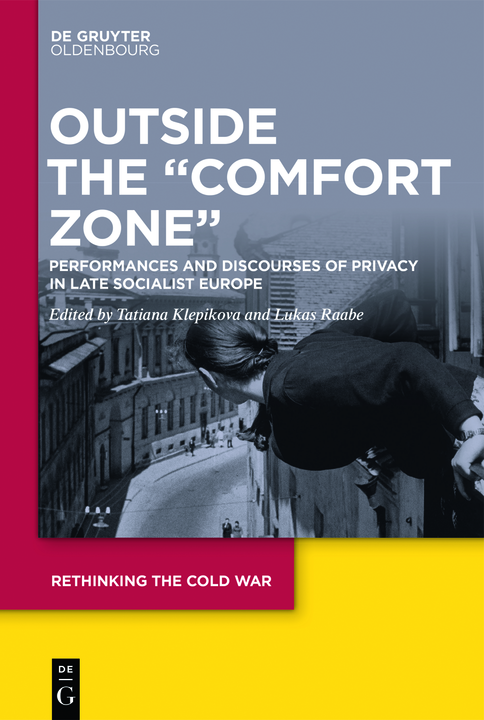
Klepikova, Tatiana/Raabe, Lukas (Hrsg.) (2020): Outside the "Comfort Zone". Performances and Discourses of Privacy in Late Socialist Europe. Oldenburg: De Gruyter
Traditionally, privacy studies have focused on the liberal democratic societies of the global West, whereas non-democratic contexts have played a marginal role in the discussion of the private and public spheres, not in the least because of the political stances of the Cold War era. This volume offers explorations of highly diversified performances and discourses of privacy by various actors which were embedded into the culturally, economically, and politically specific constructions of late socialism in individual states of the Warsaw Pact. While the experience of socialism varied across the Bloc, there were also some reactions to socialism and some reverse responses of socialist regimes to these reactions that one can trace through all states. Contributions to this volume take us across the Eastern Bloc and beyond it—from the Soviet Union, into late socialist Poland, Romania, and East and West Germany. While looking at specific countries, they provide a glimpse into a broader perspective that reaches beyond the borders of individual late socialist states. Together, these articles document a palette of paradigms of the construction and transformation of the private spheres that overcame the national borders of individual states and left an imprint across the Eastern Bloc, thereby contributing to rethinking Cold War rhetoric in regard to these states.
Tatiana Klepikova and Lukas Raabe: On Privacy and Its “Comfort Zones”. Revisiting Late Socialist Contexts
Beyond the Everyday: Social Performances of Privacy
Lewis H. Siegelbaum: Kak u sebia doma. The Personal, the Private, and the Question of Privacy in Soviet Russia
Jon Berndt Olsen: Opportunities and Boundaries of Personal Autonomy in East GermanTourism
Natali Stegmann: Negotiating Social Needs. Ideas of a Good Life in Late Socialist Poland
Agnieszka Sadecka: The Private and The Public in Polish Reportage from Late Socialism
The Sounds of Youth: From Private Flats to Public Stages
Andra-Octavia Cioltan-Drăghiciu: The Sad Butterflies of the 1980s. Sexual Intimacy among Youths in 1980s’ Romania
Claudiu Oancea: Rocking Out Within Oneself. Rock and Jazz Music between the Private and the Public in Late Socialist Romania
Xawery Stańczyk: “There’s No Silence in a Block of Flats”. Fluid Borders Between the Privateand Public Spheres in Representationsand Practices of Punk in Socialist Poland
The Elusive Narrated Self: Literary and Cinematic Explorations
Irina Souch: Without Witness. Privacy and Normal Life in Late Soviet Cinema
David Gillespie: The Overturned House. The Tension between the Public and the Private in Late Soviet Culture
Christina Jüttner: The Private and the Public in the Life Writings of Dissenters in Late Socialist Russia. A Female Perspective
On Both Sides of Surveillance and Doctrine: (Re‐)Claiming Agency
Mirja Lecke: Privacy, Political Agency, and Constructions of the Self in Texts Written by Dissidents
Thomas Goldstein: Privacy as a Weapon? The Mysterious Health of Hermann Kant
Lukas Raabe: Privacy “Detached from Purely Private Tendencies”. Preserving Interpretational Control in Marxist-Leninist Discourses of the Late Socialist GDR
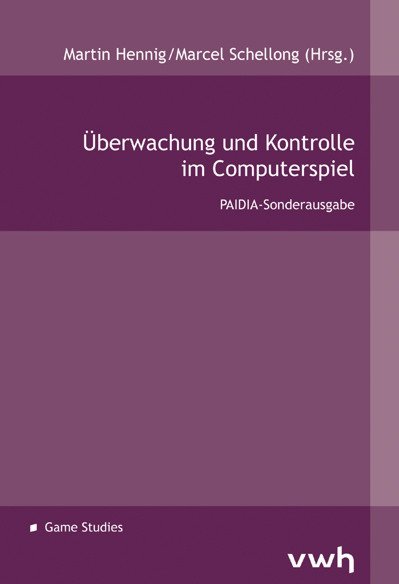
Hennig, Martin/Schellong, Marcel (Hrsg.) (2020): Überwachung und Kontrolle im Computerspiel. PAIDIA-Sonderausgabe. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch.
Überwachung und Kontrolle sind zentrale Themen im Diskurs der digitalen Gegenwartskultur. Computerspielen kommt dabei eine besondere Funktion zu, denn sie können einerseits – in motivgeschichtlicher Tradition – an die Darstellung und Verhandlung von Überwachung und Kontrolle in anderen medialen Formen anschließen. Andererseits ermöglicht das spezifische Handlungsdispositiv des Computerspiels einen erweiterten Blick auf Überwachungs- und Kontrollformen digitaler Medien und erweist sich gegenwärtig gleichzeitig als deren zentraler Reflexionsort.
Der vorliegende Band versammelt zwölf medien- und kulturwissenschaftliche Beiträge, die Überwachung und Kontrolle im Computerspiel als Erzählmotive und Spielstrukturen untersuchen und digitale Spiele als Teile von Überwachungs- und Kontrollgesellschaften perspektivieren.
Martin Hennig, Marcel Schellong: Einleitung
Sektion 1: Überwachung und Kontrolle als Spielmotive
Martin Hennig: Watch Dogs und die Heterotopie der Überwachung. Motive, Strukturen und Funktionen überwachter Welten in digitalen Spielen
Simon Hagemann: Das Spiel mit den Daten. Zur Rezeption und Simulation datenbasierter Überwachung in einigen zeitgenössischen Computerspielen
Jasmin Pfeiffer: Datenüberwachung in Orwell: Keeping an Eye on You
Daniel Illger: Der ohnmächtige Held. Die Fantasy-Welt als Kontrollgesellschaft in The Banner Saga
Martin Ramm: Kontroll- und Selbstverlust in The Observer
Sektion 2: Überwachung und Kontrolle des Spiels
Stefan Höltgen: Das magische Panoptikum. Technologien der Überwachung zum Zweck des Spiels – eine computerarchäologische Analyse
Bojan Peric: Alles außer Kontrolle? Kontrollvergabe und -wegnahme im digitalen Spiel
Kai Matuszkiewicz: Spielerisch wissenschaftlich Schreiben lernen? Das gamifizierte wissenschaftliche Schreibforum Being a Scientist
Sektion 3: Digitale Spiele als Teile von Überwachungs- und Kontrollgesellschaften
Christopher Lukman: Spielen in der Kontrollgesellschaft. Für eine Theorie des Kontrolldispositivs Computerspiel
Lars Dolkemeyer: Menschen, Monster, Algorithmen. Interface-Inszenierungen im Survival-Horror von Alien: Isolation und Outlast
Ilona Mader: Computerspielplattformen als panoptische Systeme. Wie sichtbare Kontrolle und Überwachung zur Disziplinierung von Spieler_innen führen
Bernhard Runzheimer: Gotta monitor them all. Überwachungsstrategien geobasierter Augmented-Reality-Apps am Beispiel von Pokémon Go
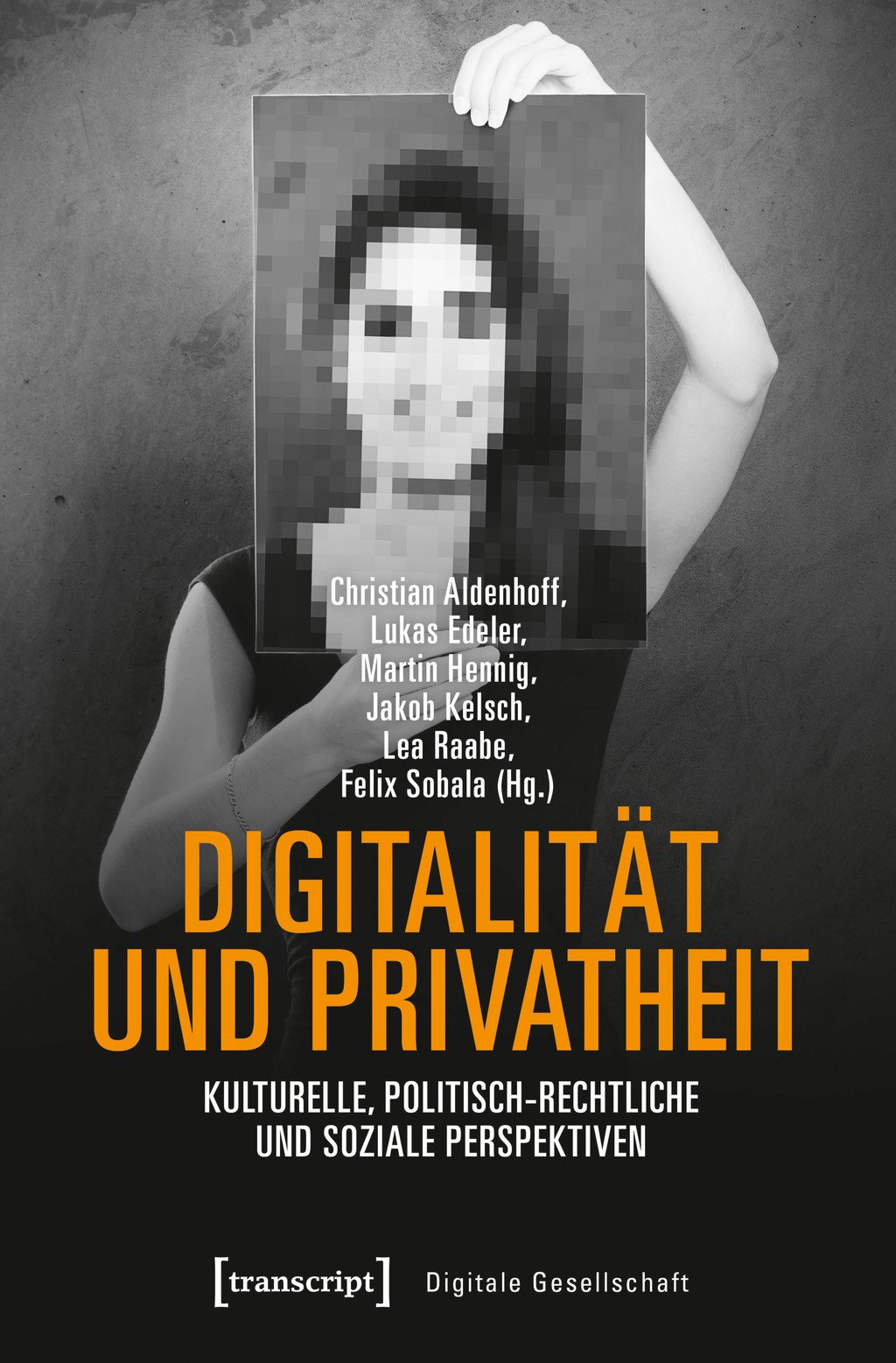
Aldenhoff, Christian/ Edeler, Lukas/ Hennig, Martin/ Kelsch, Jakob/ Raabe, Lea/ Sobala, Felix (Hrsg.) (2019): Digitalität und Privatheit. Kulturelle, politisch-rechtliche und soziale Perspektiven. Bielefeld: transcript Verlag.
Datenschutz bleibt ein umkämpftes Thema im Kontext der voranschreitenden Digitalisierung. Die Beiträge des Bandes gehen der Frage nach, welche Formen Privatheit in einer digitalen Gesellschaft annehmen kann und welche Chancen und Risiken dabei entstehen. Dabei ergeben sich medienkulturelle Fragestellungen nach den Normierungsmustern hinter digitalen Anwendungen sowie die Notwendigkeit, digitale Nutzungsszenarien zu analysieren, einzuordnen und zu bewerten.
Der interdisziplinäre Band versammelt kultur-, sozial-, medien-, rechts- und politikwissenschaftliche Perspektiven.
Martin Hennig, Jakob Kelsch und Felix Sobala: ›Smarte Diktatur‹ oder ›egalitäre Netzgemeinschaft‹? Diskurse der Digitalisierung
Sektion 1: Politisch-rechtliche Diskurse
Martin Hennig, Jakob Kelsch und Felix Sobala: Einleitung
Christian Aldenhoff: Legitimation von Datenverarbeitung via AGB? Wider eine Verlagerung von datenschutzrechtlichen Abwägungen in das Vertragsrecht
Karsten Mause: Schutz der (digitalen) Privatsphäre als Staatsaufgabe? Eine polit-ökonomische Analyse
Andreas Spengler: Technologisierung der Lebenskunst — Subjektivierung und Digitalität
Louisa Specht-Riemenschneider und Dennis Jennessen: Persönlichkeitsschutz im digitalen Umfeld in Zeiten der Mehrebenenregulierung
Sektion 2: Zwischen Öffentlichkeit, Privatheit und Privatisierung — soziale Kollektive im Netz
Martin Hennig, Jakob Kelsch und Felix Sobala: Einleitung
Paula Helm und Johannes Eichenhofer: Reflexionen zu einem social turn in den privacy studies
Benjamin Heurich: Unsocial Bots — Eine Gefahr für die Autonomie des Gesellschaftssystems
Lea Raabe: Die Kommentarspalten des Online-Magazins COMPACT als privatisierte Echokammer
Sebastian J. Golla, Henning Hofmann und Matthias Bäcker: Connecting the Dots Sozialwissenschaftliche Forschung in sozialen Online-Medien im Lichte von DS-GVO und BDSG-neu
Sektion 3: Mediale Formen und Verhandlungen von Privatheit in Zeiten der Digitalisierung
Martin Hennig, Jakob Kelsch und Felix Sobala: Einleitung
Axel Kuhn: Reader Analytics: Vom privaten zum öffentlichen Lesen?
Gala Rebane: Aushandlung und Inszenierung des Privaten in room tour-Videos
Marcella Fassio: »Ich erfinde nichts, ist alles, was ich sagen kann«. Praktiken der Subjektivierung zwischen Privatheitund Inszenierung in Wolfgang Herrndorfs Blog Arbeit und Struktur
Amy Lynne Hill: ‘GRWM’: Modes of Aesthetic Observance, Surveillance, and Subversion on YouTube
Bärbel Harju: »The Glass Room« — Privatheit in digitalen Kunstprojekten
Jakob Kelsch: »Transparente Individuen im intransparenten System«. Das Spannungsfeld von Privatheit und Digitalisierung in Marc-Uwe Klings Roman QualityLand
Burk, Steffen/Klepikova, Tatiana/Piegsa, Miriam (Hrsg.) (2018): Privates Erzählen. Formen und Funktionen von Privatheit in der Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts. Berlin: Verlag Peter Lang.
Wie kann "Privates" erzählt werden? Welche narrativen Verfahren werden eingesetzt, um "Privatheit" literarisch darzustellen? In welcher Relation steht das "Private" in der Literatur zu "Öffentlichkeit" und "Überwachung"? Diese Fragen stehen im Zentrum des Bandes, in dem die Autor/innen anhand ausgewählter Texte die mit Privatheit verbundenen Themen, Motive und Strukturen rekonstruieren und in Beziehung zueinander setzen. Die Beiträge nehmen sich dabei der Aufgabe an, die Repräsentationen und Inszenierungsweisen von Privatheit zu rekonstruieren und herauszuarbeiten, auf welche Weise das Private in literarischen Texten des 18. bis 21. Jahrhunderts dargestellt, semantisiert und bewertet werden kann.
Steffen Burk: Einleitung
I. Privatheit und Öffentlichkeit als semantische Oppositionen
Steffen Burk: Privatheit und Öffentlichkeit als semantische Oppositionen. Vorbemerkungen
Felix Knode: Privatheit(en) unter dem Vorzeichen der Empfindsamkeit. Modellierungen von Ich-Entfaltung und Ich-Isolation in Friedrich Heinrich Jacobis Woldemar
Sarah Maria Teresa Goeth: Private Räume und intimes Erzählen bei Novalis
Patricia Czezior: Private Innerlichkeit als Gegenentwurf zur Gefahr des Gefangenseins im öffentlichen Alltag des Philisters. E.T.A. Hoffmanns Goldner Topf und die Metamorphose des Anselmus
Steffen Burk: Privatheit und Öffentlichkeit in Thomas Manns Buddenbrooks
Nicolas von Passavant: Vom Bett aus in die Moderne. Die ›Urhütte‹ als Reflexionsraum literarischer Exzentrik
Roxanne Phillips: Schweigende (Selbst-)Führung. Innerlichkeit und Subjektivierung des working girls in Streeruwitz’ Jessica, 30.
II. Privatheit und Überwachung. Semantiken des Verlusts
Tatiana Klepikova: Privatheit und Überwachung. Vorbemerkungen
Kai Fischer: Privat fernsehen. Dystopische Erzählungen über ein neues Massenmedium
Sabrina Huber: »Aber privat sein war so gar nicht sein Fall«. Räume des Privaten in den Überwachungsromanen Corpus Delicti von Juli Zeh und Fremdes Land von Thomas Sautner
Bärbel Harju: »All that happens must be known«. Selbstüberwachung und Transparenz in Dave Eggers’ The Circle
Martin Hennig: Von Kreisen und Nullen, Massen und Medien, Mythen und Geistern. Kulturelle Bedeutungsverhandlungen digitaler sozialer Netzwerke
III. Private Texte. Spannungsfelder, Wechselspiele und poetologische Strategien
Miriam Piegsa: Private Texte. Vorbemerkungen
Sarah Alice Nienhaus: Bricolage. Praktiken des Entscheidens in Arthur Schnitzlers Jugend in Wien. Eine Autobiographie
Mandy Dröscher-Teille: Privatheit als »male oscuro«. Ingeborg Bachmanns Malina und die Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit zwischen Diskretion, Voyeurismus und Tabubruch
Jonathan A. Rose: Öffentlich und/oder privat. Fanfiction und das Internet
Burk, Steffen/Hennig, Martin/Heurich, Benjamin/Klepikova, Tatiana/Piegsa, Miriam/Sixt, Manuela/Trost, Kai Erik (Hrsg.) (2018): Privatheit in der digitalen Gesellschaft. Internetrecht und Digitale Gesellschaft, Band 10. Berlin: Duncker & Humblot.
Die Digitalisierung ist mit ihren Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft das privatheitsrelevante Thema der vergangenen Jahre. Prozesse der Digitalisierung führen zu Schwierigkeiten des Schutzes von privaten Informationen und ziehen Forderungen nach technischen Maßnahmen oder einer rechtlichen Regulierung nach sich.
Die in diesem interdisziplinären Band versammelten Fachbeiträge nehmen aus philosophischer, medien- und kulturwissenschaftlicher sowie juristischer Perspektive privatheitsrelevante Problemfelder der Digitalisierung in den Blick. Dazu gehören Fragen hinsichtlich informationeller Privatheit, Vertrauen und Verantwortung in digitalen Kontexten, Beiträge zu Freundschaften und Beziehungsgestaltung im Internet, Scoring-Systemen oder Nudging sowie Perspektiven der Roboterethik und Technikphilosophie.
Miriam Piegsa und Kai Erik Trost: Privatheit in der digitalen Gesellschaft. Von Fragen der Subjektbildung und ethischen Grenzbereichen, Veränderungen sozialer Beziehungen und rechtlichem Regulierungsbedarf
1. Privatheit und das digitalisierte Subjekt
Armin Grunwald: Abschied vom Individuum – werden wir zu Endgeräten eines global-digitalen Netzes?
Benjamin Heurich: Privatheitsschutz als Gemeinwohl – Vertrauen und Sicherheit in digitalen Gemeinschaften
Tobias Matzner: Der Wert informationeller Privatheit jenseits von Autonomie
Volker Gerhardt: Öffentlichkeit und Bewusstsein
2. Digitalität als ethisches Handlungsfeld
Klaus Mainzer: Digitale Würde? Sensoren, Roboter und Big Data zwischen Selbstorganisation und Selbstbestimmung
Christian Thies: Verantwortung im digitalen Weltsystem. Grundsätzliche Überlegungen zu einem neuen Bereich angewandter Ethik
Julia Maria Mönig: Verhaltensbeeinflussung durch Werbung in der Massengesellschaft
3. Digitale Kulturen und Vergemeinschaftung – soziale Aspekte
Kai Erik Trost: Der private Freundschaftsraum im digitalisierten Umfeld. Eine empirischsemantische Analyse einer jugendlichen Freundesgruppe
Daniela Wawra: Beziehungsgestaltung in der digitalen Gesellschaft: Privatheit und Intimität im Kommunikationskontext sozialer Medien
Alexander Krafka: Das intime Bild. Rechtliche Grenzen von Privatheit in der digitalen Gesellschaft
Tatiana Klepikova: Digital Russians’ Home and Agora: The Runet between the Private and the Public Spheres
4. Staatliche Regulationsmöglichkeiten in der Datengesellschaft
Tobias O. Keber: Stützen der Informationsgesellschaft – zur Rolle von Datenschutz und Datensicherheit im Mediensystem
Manuela Sixt: Scoring. Implikationen für Individuum und Gesellschaft
Barbara Sandfuchs and Andreas Kapsner: Privacy Nudges: Conceptual and Constitutional Problems
Beyvers, Eva/Helm, Paula/Hennig, Martin/Keckeis, Carmen/Kreknin, Innokentij/Püschel, Florian (Hrsg.) (2016): Räume und Kulturen des Privaten. Wiesbaden: Springer VS.
Der interdisziplinäre Band setzt sich damit auseinander, wie räumliche Aspekte die Vorstellung von Privatheit in westlichen Gesellschaften beeinflussen und wie verschiedene Kulturen des Privaten daran beteiligt sind, spezifische Räume zu erschaffen. Die Autorinnen und Autoren fokussieren auf aktuelle Entwicklungen und stellen vor allem das Zusammenspiel von realen und digitalen Räumen in den Mittelpunkt. Ihre Beiträge beleuchten räumliche und kulturelle Aspekte von Privatheit aus kultur-, medien-, sozial- und rechtswissenschaftlicher Perspektive und erschaffen damit ein weites Panorama diverser Problemfelder, die heute immer deutlicher in den Vordergrund rücken.
Eva Beyvers, Paula Helm, Martin Hennig, Carmen Keckeis, Innokentij Kreknin und Florian Püschel: Einleitung
Carmen Keckeis: Privatheit und Raum – zu einem wechselbezüglichen Verhältnis
Martina Ritter: Privatheit als Aneignungsprozess im Sozialen Raum. Migrantinnen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft
Anna Wanka: Spaces and practices of privacy in older age. The blurring of boundaries between the private and the public across the life course
Thorsten Benkel: Künstliche Intimität . Inszenierungen veröffentlichter Privatheit im Kontext der Prostitution
Thomas Christian Bächle: Das Smartphone, ein Wächter. Selfies, neue panoptische Ordnungen und eine veränderte sozialräumliche Konstruktion von Privatheit
Ramón Reichert: „Make it count!“ Biomedialität im Kontext von Self-Tracking und Social Media
Bärbel Harju: Privatheit und Suburbanisierung in den USA der Nachkriegszeit
Martin Hennig: Big Brother is watching you – hoffentlich. Diachrone Transformationen in der filmischen Verhandlung von Überwachung in amerikanischer Kultur
Bart van der Sloot: Privacy as virtue: searching for a new privacy paradigm in the age of Big Data
Julia Rußmann: Die Lüge im Vorstellungsgespräch. Schutz der Privatheit im Arbeitsrecht
Anastasia Sitte: Kann das Heim von Prominenten eine ‚Burg‘ sein? Zum zivilrechtlichen Schutz prominenter Persönlichkeiten vor unerwünschten identifizierenden medialen Beschreibungen ihrer häuslichen Privatsphäre nach deutschem und russischem Recht
Alexander Seidl und Tobias Starnecker: Cybercrime: Angriff auf die Privatsphäre im virtuellen Raum
Frank Braun: Warum die Geheimdienste unsere Privatsphäre gefährden .Rechtsstaatliche Defizite im Recht der Dienste
"Der Diskurs der Privatheit ist sowohl in deutschen Medien als auch global allgegenwärtig. Dabei ist nicht nur die Häufigkeit, sondern vor Allem die Diversität der sich entfaltenden Debatten signifikant. [...] Auffällig ist, dass in den Diskussionen besonders dem Schutz der Privatheit eine besondere Rolle zugemessen wird. Da hier zwischen individuellen, wirtschaftlichen und staatlichen Interessen abgewogen werden muss, berührt der Schutz der Privatheit [...] alle Ebenen der Gesellschaft. (Garnett/Halft/Herz/Mönig 2013: S. 8)
Vorwort
Martin Hennig, Steffi Krause, Florian Püschel: Einleitung
Elena Zanichelli: Protagonsiten werden gefragt! Zur künstlerischen Begegnung mit dem Privatleben Anderer in den 1990er Jahren oder: Die Kamera greift ein. Gotte Villesens Ingeborg the Busker Queen
Martin Hennig: Playing Privacy - Analysesätze und Aspekte von Privatheit im Online-Rollenspiel
Martin Degeling: Profiling, Prediction und Privatheit. Über das Verhältnis eines liberalen Privatheitbegriffs zu neueren Techniken der Verhaltensvorhersage
Knut Fournier: A Public Cry, a Sign in the Garden? Recent Legal Restrictions on Twitter Users' Right to Privacy
Thomas Dienlin: The Privacy Process Model
Gernot Howanitz: Kommunalka 2.0. Zur Kontinuität sowjetischer Privatheitskonzeptionen im Runet
Thomas Schwabenbauer: Prominente und ihr Recht am eigenen Bild. Zum (un-)angemessenen Schutz der Selbstdarstellung, Selbstdistanzierung und Selbstvergewisserung durch das Kunsturhebergesetz
Elena Paletti: The Scandals of Caroline, Max and Kate. Does Celebrity Privacy Threaten Press Freedom in the Internet Age?
Ina Verena Knop: Der Personenname als Schlüssel zur Privatheit. Konsequenzen im Internetzeitalter und namensrechtlicher Handlungsbedarf
Carsten Ochs: Privat(heit) im Netz(werk). Internet Privacy zwischen kollektiver Normierung und individueller Kalkulation
Marcel Berlinghoff: Computerisierung und Informationsenteignung. Privatheit in computerbezogenen Diskursen der 1970er und 1980er Jahre
Christian Lewe: Von der Publizität des Persönlichen. „The Right to Privacy" als Strategie liberaler Regierung
Dietmar Kammerer: Die Enden des Privaten. Geschichten eines Diskurses
"Die Zahl einschlägiger Medienberichte dokumentiert eindrücklich, dass die Relevanz des Themas 'Privatheit' ungebrochen ist. Diese Aktualität verweist darauf, dass sich das, was als Privatheit verstanden wird, worin sie sich artikuliert oder überhaupt artikulieren kann, heute mehr denn je verändert. [...] Privatheit steht in einem Spannungsfeld, das für die Gesellschaft auf vielen Ebenen relevant ist." (Halft/Krah 2013: S. 7)
Vorwort
Marion Albers: Privatheitsschutz als Grundrechtsproblem
Ünal Bilir: Die Verletzung der Privatsphäre im Namen der politischen Moral
Thomas Waitz: Privat/Fernsehen. Fernsehen, Bürgerlichkeit und die Konstruktion des Privaten
Elena Zanichelli: Rhetoriken des Privaten: Zur Kritik an kulturellen Vernaturalisierungen des Privaten in künstlerischen Arbeiten von Felix González-Torres und Monica Bonvicini
Jens Ruchatz: Vom Tagebuch zum Blog. Eine Episode aus der Mediengeschichte des Privaten
Jan-Hinrik Schmidt: Persönliche Öffentlichkeiten und Privatsphäre im Social Web
Jan-Oliver Decker: „Willkommen in unserer Community" — Multimediale Kommunikation über Erotik und ihre Funktion für die Konzeption der Person in Internetportalen für homosexuelle Männer
Gräf, Dennis / Halft, Stefan / Schmöller, Verena (2011): Privatheit. Formen und Funktionen. Reihe: Medien, Texte, Semiotik Passau. Hrsg. von Hans Krah. Band 3. Passau: Stutz.
"In Zeiten von social networks sowie des sogenannten Web 2.0 wird kein Thema so kontinuierlich verfolgt und diskutiert wie das der Privatheit. Wieviel Einblick gibt man freiwillig in sein Privatleben, was gilt als privat bzw. was wird als Privates inszeniert und ist doch schlussendlich nur ein Teil der öffentlichen Person?" (Gräf/Halft/Schmöller 2011: S. 7)
Vorwort
Dennis Gräf/Stefan Halft/Verena Schmollet: Privatheit. Zur Einführung
Birgit Aka: Ruhe und Rua - Privatheitskonzepte in Brasilien und Deutschland
Tobias Waldmann: Privatheit im Wandel vom fordistisch organisierten zum flexiblen Kapitalismus
Markus Grottke: Geheimhaltung und Unternehmenspublizität während der Finanzkrise — berechtigte und unberechtigte Grenzziehungen aus der Perspektive des öffentlichen Raums
Michaela Weigl: Der Schutz der Privatsphäre vor den Medien
Peter Kainz: Ideologie der Privatheit - Notwendigkeit des Exhibitionismus? Zum Dilemma des neuzeitlichen Individualismus
Helene Schmolz: Privatheit im Internet: Von Möglichkeiten und Gefahren digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien
Stefan Halft: Privacy — the right to clone? Zur Semantik und Funktion von ,Privatheit' im Teildiskurs über das reproduktive Klonen von Menschen
Benedikt Kühnen: „Es ist cool, eine Familie zu gründen!" — Zur medialen Inszenierung von Privatheit und Intimität in der Doku-Soap WIR SIND SCHWANGER (D 2008)
Bernhard Mitterer: Mit den Stars per Du: Parasoziale Beziehungen — die Illusion privater Beziehungen von Zuschauern und Medienakteuren